Hellwach durchs Leben
(Apothekenumschau)Vom Kindergarten bis zum Altersheim: Fit im Kopf bleibt nur, wer seine Hirnzellen genauso trainiert wie seine Muskeln
Sebastian mag die Fünf, weil er genau so alt ist; Anja zieht die Eins vor, weil die immer die erste ist; Klara liebt die Zwei, weil die im Zahlenbuch so schön gelb ist: Im Kindergarten Unterföhring 1 bei München sind Zahlen seit kurzem fast so beliebt wie Kuscheltiere.
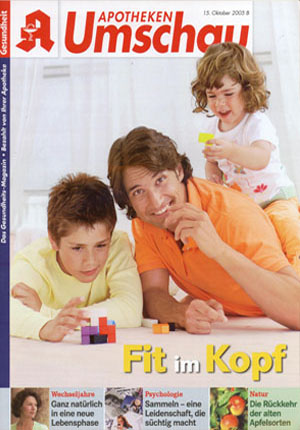
© Apothekenumschau
„Wer muss sich mit wem zusammen tun, damit alle fünf Steine haben?", fragt Erzieherin Olivia Stiegeler, 49, die Kinder, die vor ihr in der Turnhalle zwischen Gummibällen und Sprossenwand kauern. Eifrig rutschen sie hin und her bis alle den richtigen Partner gefunden haben. Sebastian angelt seine zwei Steine aus dem blauen Baumwollsäckchen und schiebt sie zu den drei Kieseln, die Marvin vor seinen Knien getürmt hat. „Fünf!" jubelt er.
Was aussieht wie ein Kinderspiel, gehört zu einem Trend, der überall an Bedeutung gewinnt, seitdem PISA Deutschland erschüttert hat. Immer mehr Menschen wird immer klar, dass Lernen ein lebenslanger Prozess sein kann. Sie werden bestätigt von den Neurowissenschaftlern, die unter anderem mi Hilfe der modernen bildgebenden Verfahren wie PET oder fMRT immer besser verstehen, wie das Gehirn arbeitet: Bereits Dreijährige können eine Fremdsprache erlernen, Erwachsene sollten an Charakter und Intellekt feilen, damit sie noch als Senioren lange geistig fit bleiben. Langsam sickert ins öffentliche Bewusstsein, dass Wissenschaftler für jedes Lebensalter Strategien entwickelt haben, wie man seine grauen Zellen am besten trainiert. Man muss es nur tun!
Frühe Übung, kleine Meister
Deshalb beteiligt sich der Unterföhringer Kindergarten an einem Projekt des Freiburger Didaktikers Gerhard Preiss: "Komm mit ins Zahlenland" taufte dieser sein Konzept, bei dem kleine Kinder mit Geschichten, Abzählreimen, Liedern und Basteln den Zahlenraum von eins bis zehn spielerisch erkunden.
Kinder kommen nicht mit einem leeren Kopf zur Welt, der erst in der Schule mit Fakten gefüllt werden muss. Lernen beginnt im Mutterleib. Bereits im siebten Monat unterscheiden Föten akustische Reize. Von Geburt an ist ein Kind eine hochmotivierte Lernmaschine, die mit rasender Geschwindigkeit die Welt erobert. Schnell vernetzen sich die Nervenzellen des Hirns über die so genannten Synapsen, bis am Ende des zweiten Lebensjahres ein Höhepunkt erreicht ist. Dann beginnt eine kritische Phase: Vom 3. bis zum 6. Lebensjahr lichtet sich der Synapsen-Dschungel und gewinnt an Struktur. Je nach Nutzung verstärken sich manche Verbindungen, andere verkümmern.
"In dieser Zeit werden prägende neuronale Netze angelegt, die das ganze Leben lang wirksam bleiben", warnt Preiß. "Nutzt man diese Zeit nicht, so entwickeln sich einige Anlagen nicht mehr optimal." Deshalb plädiert der Neuro-Didaktiker für Frühförderprogramme, mit dem Kinder die mathematische Sprache ähnlich mühelos erwerben könnten wie die mindestens so komplizierte Muttersprache. Mittlerweile haben Hirnforscher Zeitfenster ausgemacht, in dem Kinder bestimmte Fähigkeiten besonders leicht erlernen:
- Das Bewegungslernen beginnt bereits in der Schwangerschaft und festigt sich meist automatisch bis zum 4. Lebensjahr.
- Sprachen lernt man am besten bis zum 4. Lebensjahr. Nach der Pubertät erlernen nur noch Ausnahmetalente eine Fremdsprache akzent- und fehlerfrei.
- Ein Instrument erlernt man am leichtesten zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr. Früher Musikunterricht fördert auch das logische Denken.

© dreamstime
Gelungene Frühförderung bedeutet, spielerisch auf die natürliche Wissbegierde von Kindern einzugehen. Sie lernen bereitwillig, weil es ihnen hilft, sich besser an ihre Umwelt anzupassen.
Verheerend wäre es jedoch, wenn Eltern Leistungsdrill im Kinderzimmer fordern. Denn es lernt nur, wer motiviert ist – und Kleinkinder sind von Natur aus motiviert. Eltern und Erzieher sollten den Kindern spannende Angebote machen, aus denen sie frei wählen können. Der Lernstoff sollte Augen, Ohren, Nase und Tastsinn ansprechen und in Bezug zur Kinderwelt stehen.
Fachleute weisen zudem darauf hin, dass Fehlermachen zur Lernentwicklung gehört und die Kleinen Zeit benötigen, Dinge selbst auszuprobieren. "Wenn Kinder viele kleine Erfolge erringen, wenn man ihnen das Gefühl gibt, klüger zu werden, dann macht ihnen das Lernen auch Spaß", sagt Psychologin Elsbeth Stern vom Berliner Max-Plank-Institut für Bildungsforschung.
Knochenarbeit am Hirn
Eine anregende und emotional positive Umgebung kann sich auf Kinder enorm auswirken. Denn Intelligenz ist nicht komplett angeboren. Vermutlich liegt der ererbte Anteil bei 50 Prozent, wenn man sie so definiert, wie es Psychologen klassischerweise tun, um den so genannten IQ mit Hilfe von Tests zu ermitteln: Intelligenz sei das Vermögen eines Menschen, zu verstehen, zu abstrahieren und Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden und Sprache zu gebrauchen. Erst um das zehnte Lebensjahr festigt sich der so beschriebene IQ als ein Ergebnis der Wechselwirkung von Genen und Umwelt.
Was möglich ist, belegte eine Studie des Londoner Entwicklungspsychologen Michael Rutter, der das Schicksal von 110 vernachlässigten rumänischen Waisenkindern verfolgte, die nach dem Sturz des Ceausescu-Regimes nach England adoptiert wurden: Der durchschnittliche IQ der Gruppe stieg dramatisch von 63 auf 107 Punkte!
Wer erst als Erwachsener einen IQ-Test macht und – vom Ergebnis erschreckt – etwas für seine grauen Zellen tun will, muss andere Wege beschreiten. Der klassische IQ-Wert gilt bei Erwachsenen als stabile Eigenschaft. Verzweiflung ist dennoch nicht angebracht. Zum einen lässt sich ein niedrigerer IQ-Wert durch Vorwissen und Üben kompensieren Hinzu kommt, dass viele Forscher bezweifeln, dass der klassische IQ überhaupt zuverlässig Erfolg in Beruf und Leben voraussagt. Brauchbar sei er für das abstrakts Problemlösen etwa an der Universität. Wer aber als Manager gut auftreten, als Chef sein Team motivieren oder als Ingenieur in der Produktion schnell mal improvisieren muss, der benötige ganz andere Fähigkeiten. Ähnliches gelte für musische und kreative Berufe oder die Frage, wie man seine Familie managt.
Das war der Grund, wieso der Psychologe Howard Gardner von der Universität Harvard Mitte der 80er Jahre forderte, sieben Arten der Intelligenz zu unterscheiden: sprachliche, musikalische, logisch-mathematische, räumliche, körperlich-kinästhetische, interpersonale und intrapersonale Intelligenz. In eine ähnliche Richtung ging der Versuch von Gardners Kollegen Daniel Goleman, eine emotionale Intelligenz zu umreißen, die vom richtigen Gebrauch der Gefühle handelt.
Zwar bleibt unstritten, ob man hier immer von Intelligenz reden muss, oder ob Gardners Aufteilung nicht viel mehr von allgemeinen Lebenskompetenzen handelt. Die gute Nachricht jedenfalls lautet, dass es sich zum Teil um Persönlichkeitseigenschaften handelt, an denen man auch als Erwachsener noch feilen kann. Langzeitstudien und Ergebnisse aus den Laboren der Neurowissenschaftler widerlegen das Dogma, wonach mit der Pubertät der Charakter zementiert sei.
Mit den modernen bildgebenden Verfahren haben Forscher schon längst die andauernde Plastizität – Formbarkeit - des Hirns nachgewiesen und belegt, wie Psychotherapie das Gehirn verändert. Deshalb forderte der kürzlich verstorben Theapieforscher Klaus Grawe. "So wie man einen Muskel erst wieder aufbauen muss, wenn man wochenlang im Krankenbett gelegen hat, muss man auch für neue synaptische Bahnen üben."
Diese Einsicht gilt für alle Veränderungsprozesse im Hirn: Wer seine Schüchternheit abbauen oder seine Gelassenheit stärken, sein Gedächtnis verbessern oder eine neue Sprache lernen will, der muss in der realen Welt trainieren. Es reicht nicht, einen Ratgeber zu lesen. Anders als beim Kleinkind, geschieht das beim Erwachsenen nicht mehr spielerisch: Lernen beim Erwachsenen ist Knochenarbeit am Hirn. Da gilt es einiges zu beachten.
- Spaß und Motivation ist genauso wichtig wie im Kindergarten: Es ist fruchtlos, seinen Ehepartner gegen seinen Willen in einen Sprach- oder Computerkurs zu drängen.
- Umzüge und Berufswechsel sind auch Chancen. Wenn man sich ändern will, geht das leichter im neuen Kontext.
- Die Rückmeldung anderer Menschen ist wichtig: Wenn alle schon eine feste Meinung über einen haben, ist es schwierig, sich zu verändern. Das spricht dafür, den Kurs "social skills" nicht mit den Kollegen bei der betrieblich Weiterbildung zu buchen, sondern bei der VHS.
Nichts machen, gilt nicht. Wir leben nämlich immer länger, dennoch lässt die geistige Schnelligkeit wie eh und je ab dem 25. Lebensjahr nach. Neu ist die Einsicht, dass man vieles dagegen tun kann. Die wichtigste Handlungsanleitung der modernen Hirnforschung lautet hier: "Use it or loose it.!"
"Man muss seinen Geist quälen", fordert Psychogerontologe Wolf-Dieter Oswald von der Universität Erlangen. Es genüge nicht, Gedichte auswendig zu lernen, man müsse selber aktiv und kreativ werden, zum Beispiel nach der Zeitungslektüre die Meldungen in eigenen Worten zusammenfassen. Eine solche Übung beuge sogar Alzheimer vor. Oswald ist auch der Erfinder des so genannten SIMA-Trainings (Selbststän-digkeit im hohen Alter), einem Programm, bei dem Gedächtnistraining mit körperlicher Aktivität vereint wird. Denn auch Ausdauersport scheint dem Wachstum von Nervenzellen zu dienen, die beim Erinnern helfen.
Der lange Weg zur Weisheit
"Um Stress zu vermeiden, sollte man sein Leben so früh wie möglich, vernünftig organisieren", rät Paul Baltes, Direktor des Berliner Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung. "Gerade junge Erwachsene zwischen 30 und 40 stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, Beruf und Familie zu vereinbaren." Bereits ihnen empfiehlt er das von ihm so benannte SOK-Modell, um dauerhaft fit im Kopf zu bleiben: selektive Optimierung mit Kompensa- tion.
Erstens müsse man aus den vorhandenen Lebensmöglichkeiten diejenigen auswählen, die man umsetzen wolle. Zweitens müsse man optimieren, also geeignete Mittel suchen, um das Gewählte möglichst gut zu tun. Drittens Kompensation: Wenn im Laufe des Lebens Mittel wegfallen, sollte man flexibel genug sein, um neue Wege zu suchen, um seine Ziele zu verfolgen.
„Es gelingt älteren Menschen überraschend gut, ihr Leben in einem immer engeren Umfeld und unter körperlichen Beeinträchtigungen so einzurichten, dass sie sich ein positives Selbstgefühl erhalten.
Sie regulieren ihr subjektives Wohlbefinden, indem sie ihre Erwartungen an die Realität anpassen.
So gehe es denjenigen besser, die sich zum Beispiel zuerst ein paar Jahre auf den Beruf konzentrieren und dann auf die Familie. Je älter man werde, um so wichtiger werde das SOK-Prinzip. Baltes zitiert gern das Beispiel des Klavierspielers Arthur Rubinstein, der zu seinem 80. Geburtstag gefragt wurde, wie er es denn schaffe, immer noch als Konzertpianist zu brillieren. "Aus seinen Antworten lässt sich das SOK-Prinzip herauslesen", versichert Baltes. Er habe sein Repertoire verringert, also eine Wahl getroffen. Außerdem übe er die Stücke mehr als früher. Das ist die Optimierung. Und weil er die ausgewählten Stücke nicht mehr so schnell wie früher spielen konnte, hat er noch einen Kunstgriff angewendet: Vor besonders schnellen Passagen verlangsamte er sein Tempo; im Kontrast erschienen diese Passagen dann wieder ausreichend schnell. Das ist eine Form der Kompensation.
Wenn dann alles gut geht im Laufe so eines Lebens und man seine Persönlichkeit immer gut gepflegt hat, könne im Alter so etwas wie Weisheit entstehen, eine Eigenschaft, die den Verlust an geistiger Schnelligkeit mehr als kompensiert. Ein wirklich weiser Mensch kennt sich aus mit der menschlichen Natur, mit Beziehungen, sozialen Normen, kritischen Lebensereignissen und ihren Folgen. Er weiß, wie man Lebensentscheidungen trifft und mit Konflikten umgeht. Seinen Rat werden auch die Jungen suchen.

© dreamstime
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans umso mehr - so sollte der Satz lauten. Geistig auf der Höhe sein und bleiben, kann man auch auch im höheren Alter trainieren, etwa mit einem Computerkurs.
Ob der Münchner Ex-Friseur Edy Pipka mit seinen bloßen 60 Jahren schon weise ist? Zumindest kennt er die Unwägbarkeiten des Lebens, spätestens seitdem er eine Leukämie überstanden hat. Vor allem aber hat er die richtige Konsequenz gezogen und ist neugierig aufs Leben geblieben. Jetzt sitzt er mit sechs weiteren Männern und Frauen zwischen 60 und 75 im Münchner "Mediencenter 50 plus", um sich die weite Welt des Internets erklären zu lassen. Gerade proben sie, wie man per Mausklick einen zweiwöchigen Pauschalurlaub in Bali buchen würde.
Pipka jedenfalls hat jetzt einen DSL-Anschluss beantragt, das langsame Modem nervt, schließlich gibt es noch so viel zu entdecken auf der Welt.